Lust am Teilen
(aus: Ö1-GEHÖRT, Dezember 2017)
Ich führe seit langem eine rote Liste vom Aussterben bedrohter Wörter. Ganz oben steht das Wort „Gemeinwohl“. Die Vergötterung der Ich-AGs und die Entsolidarisierung in Teilen der Gesellschaft haben das Konzept dahinter in Vergessenheit geraten lassen. Gemeinwohl entsteht oft dadurch, dass Menschen Ressourcen teilen, statt sie für sich oder sehr kleine Gruppen zu horten.
 Nun kann man dem Netz vieles vorwerfen, etwa dass es statt zu einer informierten Demokratie zu führen, zu einer monströsen Manipulations- und Überwachungsmaschine geworden ist. Aber man muss dem Netz auch zugutehalten, dass es ein wunderbares Instrument ist, um vieles miteinander unkompliziert und gratis zu teilen – nicht nur, weil uns das herauf dräuende Weihnachten milde stimmt.
Nun kann man dem Netz vieles vorwerfen, etwa dass es statt zu einer informierten Demokratie zu führen, zu einer monströsen Manipulations- und Überwachungsmaschine geworden ist. Aber man muss dem Netz auch zugutehalten, dass es ein wunderbares Instrument ist, um vieles miteinander unkompliziert und gratis zu teilen – nicht nur, weil uns das herauf dräuende Weihnachten milde stimmt.
Mit dem Appell „Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen“ versucht etwa foodsharing.at zum Gemeinwohl beizutragen und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Die Plattform vermittelt übrig gebliebene Nahrungsmittel an soziale Einrichtungen oder bedürftige Menschen. Hobby- und Profifotografen teilen ihre Bilder unter Creative Commons-Lizenzen, über die sie genau definieren können, was die Nutzer mit ihren Fotografien kostenlos tun dürfen. Auch hier lautet das wunderbare Motto „Wenn wir teilen, gewinnt jeder!“ Und ich rede hier nicht von der Sharing Economy im Stile von AirBnB oder Uber, die vielfach ein Euphemismus für neue Geschäftsmodelle unter Aushebelung des Staates ist, sondern von echtem Teilen.
Mich beeindrucken Projekte wie die Europeana.eu – ein frei zugängliches europäisches Online-Museum mit rund 55 Millionen Exponaten. Allein 30.000 Bilder aus dem Louvre sind dort zu sehen. Wer mag, kann durch Drachenbilder stöbern, durch Folianten blättern, historische Filme ansehen oder Volksmusik aus versteckten Winkeln Griechenlands anhören. Alles gratis. Geteilte europäische Kultur ohne Zugangshürden, betretbar vom Wohnzimmer aus, via Smartphone oder Computer.
Teilen ist übrigens kein Symptom von Schwäche oder Sozialromantik. Es findet sich nach den Erkenntnissen des renommierten Verhaltensökonomen Ernst Fehr umso häufiger, je höher entwickelt eine Gesellschaft ist. Fehr hat zum Beispiel experimentell belegt, dass Menschen einen Gerechtigkeitssinn haben und auch danach handeln, selbst wenn er ihnen keinen Profit verschafft. Dass sie eine Bereitschaft haben zu teilen. Und dass beim Teilen im menschlichen Gehirn ein Belohnungssystem aktiviert wird, das Lustgefühle freisetzt.
Kinder und Kontrolle
(aus: Ö1-GEHÖRT, November 2017)
In Teilen unseres Bekanntenkreises ist es jetzt üblich geworden, die Handynutzung der Kinder per Apps zu überwachen. Da sitzt dann der elfjährige Leon auf dem Weg zu einem Fußballturnier zockend im Fonds des Autos und schreit plötzlich entnervt auf, weil sein Smartphone mitten im Spiel abbricht und nur mehr Telefonieren zulässt. Installiert hat die App die Mama, um die Handynutzung von Leon zu limitieren.
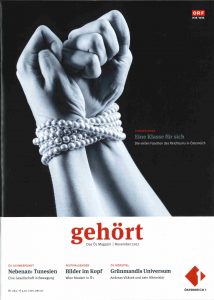 „Parental Control Apps“ nennen sich die Kontrollprogramme. Sie können nicht nur den Zugang zu Facebook beschränken oder Pornographie abblocken, man kann mit manchen Programmen sogar einen Bereich festlegen, in dem sich die Kinder bewegen dürfen. Überschreiten sie die virtuelle Grenze, löst die Software Alarm aus.
„Parental Control Apps“ nennen sich die Kontrollprogramme. Sie können nicht nur den Zugang zu Facebook beschränken oder Pornographie abblocken, man kann mit manchen Programmen sogar einen Bereich festlegen, in dem sich die Kinder bewegen dürfen. Überschreiten sie die virtuelle Grenze, löst die Software Alarm aus.
Hoppala. Klingt nach elektronischer Fußfessel, nur dass das Kind diese in der Hosen- oder Schultasche trägt. Und daher kommt auch mein Unbehagen am Großteil dieser Programme.
Hat ein Kind kein Recht auf Privatsphäre? Und vor welchen massiven Gefahren können diese Apps unsere Kinder wirklich schützen?
Erwachsenwerden besteht doch aus einem zunehmenden Überschreiten von Grenzen. Wäre ich ebenso kontrolliert aufgewachsen, hätten meine Eltern den Quelle-Katalog versperren müssen. Dieses Kompendium war aufgrund seiner Unterwäscherubrik nicht nur für mich das erste Fenster zur Anatomie des anderen Geschlechts. Genauso wenig wird ein nackter Busen im Netz Schaden anrichten. Und Pornoseiten, die tatsächlich ein falsches Bild von Sexualität vermitteln, lassen sich meist mit einem Klick in den Grundeinstellungen des Smartphones blockieren. Der Datenverbrauch ist ohnehin durch den Provider limitiert, darüber hinaus ist „das Medienverhalten der Kinder in den wenigsten Fällen derart extrem und risikofreudig, wie es in den Medien dargestellt wird“, so die Internet Service Provider Austria in ihrem Ratgeber „Internet sicher nutzen“ (gratis als Download).
Nein, ich werde am Handy des Großen nicht Papa-NSA spielen. Wir reden viel, ich erfahre viel (aber es gibt auch Geheimnisse – gut so), wir haben Abmachungen punkto elektronischer Mediennutzung. Und selbst wenn das nicht immer 100prozentig klappt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder im Geiste der elterlichen Totalüberwachung aufwachsen und sich nur mehr benehmen dürfen wie dressierte Affen. Sonst tun sie das später auch als Staatsbürger.
Innere Steinzeit
(aus: Ö1-GEHÖRT, Oktober 2017)
Wir nutzten diesen Sommer für eine ausführliche Reise durch den Osten Europas, durch Länder wie Rumänien und Bulgarien. Das einzige Licht, das bisher auf diese Regionen fiel, war jenes der Vorurteile und Ängste, bar jeglicher unmittelbaren Erfahrung. Und jetzt sage ich: die Freundlichkeit der Rumänen ist überwältigend, ebenso wie die Schönheit des Schwarzen Meeres oder bulgarischer Städte. Und dazu ließe sich noch viel mehr loben.
 Natürlich reisten wir ohne detaillierte Landkarte, primär dirigiert von Navi und Handy. Die Abschaffung des Roamings im Juni erlaubt es, auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten über das Mobilfunknetz online zu gehen. Umso überraschter war ich, als ich bereits kurz nach der ungarisch-rumänischen Grenze erhebliche Datenkosten auf meinem Mobilfunkkonto fand. Offenbar hatte sich mein kosmopolitisches Smartphone kurz in das serbische Netz gehängt. Mein Mobilfunkbetreiber nützte die Chance zum Abzocken weidlich aus und verrechnete für die 5 Megabyte – das ist nach heutigen Datenmaßstäben nicht mal ein ganzes Foto – mehr als 40 Euro.
Natürlich reisten wir ohne detaillierte Landkarte, primär dirigiert von Navi und Handy. Die Abschaffung des Roamings im Juni erlaubt es, auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten über das Mobilfunknetz online zu gehen. Umso überraschter war ich, als ich bereits kurz nach der ungarisch-rumänischen Grenze erhebliche Datenkosten auf meinem Mobilfunkkonto fand. Offenbar hatte sich mein kosmopolitisches Smartphone kurz in das serbische Netz gehängt. Mein Mobilfunkbetreiber nützte die Chance zum Abzocken weidlich aus und verrechnete für die 5 Megabyte – das ist nach heutigen Datenmaßstäben nicht mal ein ganzes Foto – mehr als 40 Euro.
Dem Ärger folgte nach kurzer Zeit eine ernüchternde Selbsterkenntnis. Es ist der Steinzeitmensch in uns, der uns solche Widrigkeiten beschert. Wir sind noch immer haptisch und visuell fixierte Wesen. Dass die Technologiekeule in unserer Hand an unsichtbaren, kilometerlangen Funkfäden hängt, unterläuft das Bewusstsein des Jägers und Sammlers. Weshalb uns die technologische Entwicklung wohl auch vor uns hertreibt, statt von uns gesteuert zu werden. Wir ziehen den Kopf ein vor den Algorithmen und Robotern, die da plötzlich aus dem Gebüsch brechen und unsere Zelte niedertrampeln. Die moderne Form des Fluchtreflexes ist die Ignoranz.
Auch Freund Herbert erlebte ein Handy-Waterloo. In einem Lokal am schicken Yppenplatz in Wien fiel ihm seine superschlanke Funkkeule zwischen den Ritzen des Terrassenbodens durch. Natürlich war es undenkbar, den am nächsten Tag beginnenden Urlaub auch als Urlaub vom Smartphone zu nehmen. Deshalb machte er sich in den umliegenden Geschäften auf die Suche nach einem Akkuschrauber und beschäftigte schließlich das halbe Lokal, um ein paar Quadratmeter Dielen zu lösen und endlich wieder zu seinem Handy zu kommen.
Aber das ist alles noch ein Klax. Freunde berichteten uns nach einem Handy-Daten-Reinfall in Bosnien-Herzegowina, dass ein Gigabyte Daten dort umgerechnet 15.000 Euro kostet.
Die Maschinen sind uns untertan
(aus: Ö1-GEHÖRT, September 2017)
Schnittlauchlocke und seine Mutter, die Liebste, sind die Zocker in der Familie. Während wir durch Osteuropa touren, holen sie fast jeden Abend einen bedrohlich dicken Packen Karten aus den Reisetaschen und setzen sich an den Spieltisch. Der Große und ich gehören eher zu den Leuten, die sich in solchen Fällen aus sozialen Gründen als Gambling-Opfer zur Verfügung stellen (ja, natürlich haben wir einen Hang zu Kartenpech und dramatisch schlechter Taktik).
 Während ich also wieder einmal fünfter von vieren war, dachte ich daran, nach einer App zu suchen, die meinen Platz am Spieltisch einnehmen könnte. Schließlich ist es üblich geworden, dass Maschinen gegen Menschen spielen. Erst vor einigen Wochen hat Googles AlphaGo gegen einen international anerkannten Go-Spieler gewonnen. Was für ein Triumpf der Maschine!
Während ich also wieder einmal fünfter von vieren war, dachte ich daran, nach einer App zu suchen, die meinen Platz am Spieltisch einnehmen könnte. Schließlich ist es üblich geworden, dass Maschinen gegen Menschen spielen. Erst vor einigen Wochen hat Googles AlphaGo gegen einen international anerkannten Go-Spieler gewonnen. Was für ein Triumpf der Maschine!
Aber nur vordergründig.
Schlagartig war es wieder da, dieses Unbehagen, wenn wir über künstliche oder maschinelle Intelligenz sprechen. Welchen Sinn macht es eigentlich, gegen einen Algorithmus anzutreten? Sollte unser Maß nicht das menschliche sein? Oder sind diese Mensch-Maschine-Turniere nicht vielmehr Propaganda-Arenen für das Silicon Valley, in dem uns die Netz-Milliardäre gefügig machen wollen für eine Zukunft, die den Maschinen gehört – und damit ihnen, da sie ja die physischen wie virtuellen Gerätschaften in ihren Händen halten?
Würden wir unsere Benchmarks anders anlegen, sähen wir sofort, wie nichtssagend derlei Mensch-Maschine-Vergleiche sind. Schon wenn wir fragen, wieviel Spaß es der künstlichen Intelligenz macht, uns Kraft ihrer Rechenleistung in die Knie zu zwingen, bekämen wir keine Antwort. Spaß ist kein Kriterium der Maschine. Wohl aber einer der wichtigsten Gründe, warum wir Menschen spielen.
Ähnlich verstörend ist der Vorschlag in einem EU-Bericht, Robotern in Zukunft eine Art „elektronische Persönlichkeit“ zuzugestehen, weil sie ja bald selbständig lernen werden und sich daher aus den Händen ihrer Programmierer emanzipieren.
Maschinen sollen Maschinen bleiben. Weil sie von uns als Werkzeuge geschaffen wurden. Egal, wieviel Intelligenz in ihren Algorithmen steckt. Und egal, wozu sie in Zukunft fähig sein werden. Wenn wir den Stecker ziehen wollen, sollen wir ihn ziehen dürfen.
Denn der Ausschaltknopf ist bei allen Geräten noch immer der Wichtigste.
Unter Wasser
(aus: Ö1-GEHÖRT, August 2017)
Kürzlich haben Wind und Wetter unseren Leseeifer ziemlich angeschlagen. Zuerst vergaß die Liebste ein Magazin auf den grünen Liegen auf der Terrasse, bevor ich die Titelstory auch nur durchblättern hätte können. Des Nachts entlud sich ein Gewitter und weichte das Papier auf. Am nächsten Morgen heizte wieder die Sonne drauf und verwandelte die Zeitschrift in einen starren Block, der nur mehr aus einer einzigen fingerdicken Seite bestand.
Ich zog ein Schnoferl, mehr nicht.
 Ein paar Tage später vergaß der Große, der gerade in Agentenromane abtaucht, den Familien-E-Reader auf nämlicher Liege. Wieder machte sich nächtens ein Regen wichtig. Dabei wurde das Lesegerät buchstäblich ertränkt. Es zeigt seitdem nur mehr den Bildschirmschoner.
Ein paar Tage später vergaß der Große, der gerade in Agentenromane abtaucht, den Familien-E-Reader auf nämlicher Liege. Wieder machte sich nächtens ein Regen wichtig. Dabei wurde das Lesegerät buchstäblich ertränkt. Es zeigt seitdem nur mehr den Bildschirmschoner.
Ich zog ein Schnoferl und verdrehte die Augen ziemlich stark.
Welche Buchstabenvernichtung soll ich jetzt besser finden? Das Magazin in seiner physischen Endlichkeit ist definitiv hin, der Schaden ist relativ klein. Der nicht mehr ganz so günstige Reader ist auch hinüber, aber die Bibliothek darauf mit gefühlten 200 Titeln lagert glücklicherweise in der Datenwolke, auf irgendwelchen Servern im Irgendwo. Kein Buch ist verloren – nur Geld.
Wenige Tage später kauften wir auch angesichts des kommenden Urlaubs ein neues Lesegerät und stellten die Bücher zurück ins virtuelle Regal. Der Große war zufrieden, weil er endlich weiterlesen konnte, maulte aber, da er auch seinen Obulus zur Neuanschaffung beisteuern musste.
Ein Plädoyer für das digitale literarische Wort ist das aber nicht, auch wenn ich es schon schätze, dass mir die kiloschweren Schmöker von erzählerisch inkontinenten Autoren wie Haruki Murakami beim Lesen nicht mehr auf die Brust drücken, weil der E-Reader nur 20 Deka wiegt. Nein, letztendlich ist es nur das Eingeständnis, dass wir über die Endlichkeit von Daten einfach nicht hinauskommen, egal ob auf Papier oder als Bits.
Wenn Sie dies lesen, bin ich schon beim thrakischen Stonehenge an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Begliktaš ist eine Art ewiger Kalender aus Fels. Und Texte in Stein sind derzeit punkto Haltbarkeit offenbar nicht zu schlagen.
Natürlich machen wir Fotos von den Megalithen. Und sobald ich heimkomme, beginnt die Daten-Paranoia von Neuem. Ich werde die Fotos herunterladen und bereits vor dem Sichten auf vier separaten Festplatten sichern. Man weiß ja nicht, wo das Wasser noch überall hinkommt.
Penetrantes Monster!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juli 2017)
Kürzlich hat mich mein Sohn gefragt, ob meine Uhr auch die Zeit anzeigen kann. Natürlich wollte mich Schnittlauchlocke auf den Arm nehmen. Ich nehme es nicht persönlich, das macht er mit allen. Seine Frage war nicht ganz unberechtigt. Denn die meiste Zeit ist das Display meiner Uhr schwarz. Meine Billigsdorfer Semi-Smart-Watch, vulgo halbvife Uhr, zählt nämlich primär meine Schritte. Wenn ich nicht 10.000 pro Tag mache, schilt sie mich, und wenn ich länger als 60 Minuten in meinem Bürosessel sitze, brummt sie wegen „zu langer Inaktivität“. Nehme ich sie auch nachts nicht ab, sagt sie mir in der Früh, wie gut ich geschlafen habe, als wüsste ich das nicht selber, wenn ich als erstes den Mann im Badezimmerspiegel überrascht grüße.
 Ich lasse die Fitness-Uhr jetzt immer öfter zuhause, weil mir ihre Penetranz auf die Nerven geht. Sie hat mir auch täglich den Kalorienverbrauch vermeldet. Wie eine Studie von Stanford-Forschern jetzt gezeigt hat, sind diese Angaben selbst bei teuren Smart Watches immer falsch und liegen weit neben dem tatsächlichen Energieumsatz, sogar die besten irrten um mindestens 20 Prozent.
Ich lasse die Fitness-Uhr jetzt immer öfter zuhause, weil mir ihre Penetranz auf die Nerven geht. Sie hat mir auch täglich den Kalorienverbrauch vermeldet. Wie eine Studie von Stanford-Forschern jetzt gezeigt hat, sind diese Angaben selbst bei teuren Smart Watches immer falsch und liegen weit neben dem tatsächlichen Energieumsatz, sogar die besten irrten um mindestens 20 Prozent.
Geräte wie Smart Watches bilden im Regelfall ein problematisches Menschenbild ab: Der Mensch als genormte, berechenbare Maschine mit einer überschaubaren Mechanik, in der ein Rädchen brav ins andere greift. Man nehme Körpergewicht, Geschlecht und Größe – und schon suggeriert uns ein unbekannter Algorithmus, er wüsste über unseren Kalorienverbrauch Bescheid. Und warum gibt es dann Menschen, die schon beim Anblick einer Schaumrolle zunehmen?
Wir gehen diesen Wirklichkeits-Simulatoren zu oft auf den Leim. Statt uns Körperbewusstsein zu geben, rauben sie es uns. Vermessungsgadgets und andere Digitalspielzeuge schaffen eigene Realitäten. Das einzige, was sie uns verlässlich geben, ist das Gefühl von Sicherheit in einer immer komplexeren Welt, das Gefühl, wir hätten unseren Körper und das ganze Rundherum eh unter Kontrolle. Deshalb gibt es zunehmend den monströsen Trend, Menschen sofort Schuld zuzuweisen, wenn sie krank werden. Denn mit dem Zufall und dem Nicht-Berechenbaren tun wir uns unheimlich schwer.
Ich trage meine Fitness-Uhr jetzt nur mehr als Uhr. Meinen Kalorienverbrauch samt Bewegung merke ich eh, wenn die Hose zwickt. Und wenn Schnittlauchlocke auf meine Körpermitte schielt.
Wahr oder falsch?
(aus: Ö1-GEHÖRT, Juni 2017)
Man kann Hunde darauf trainieren, eine Ellipse von einem Kreis zu unterscheiden. Nähert man die Ellipse immer mehr einem Kreis an, werden sie irgendwann neurotisch. Ein bisschen ähnlich fühle auch ich mich momentan. Aber nicht wegen geometrischen Ratespielen.
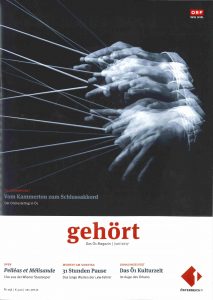 Mich irritiert vielmehr die Auflösung von wahr und falsch durch die digitalen Möglichkeiten. Jüngstes Beispiel: Lyrebird, ein Startup aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, hat einen Stimmgenerator entwickelt, der jeden Menschen nachahmen kann. Zuerst lernt das System anhand von Sprachproben, dann legt es einen Generalschlüssel, eine Stimm-DNA, ab. Mit Hilfe dieses Schlüssels lässt sich jegliche Aussage scheinbar authentisch generieren. Auf diese Art hörte ich in Demonstrationsaudios Barack Obama dieselben Sätze sprechen wie Donald Trump. Glücklicherweise klingen die Wörter im Zusammenhang noch etwas elektronisch, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der Duktus passt.
Mich irritiert vielmehr die Auflösung von wahr und falsch durch die digitalen Möglichkeiten. Jüngstes Beispiel: Lyrebird, ein Startup aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, hat einen Stimmgenerator entwickelt, der jeden Menschen nachahmen kann. Zuerst lernt das System anhand von Sprachproben, dann legt es einen Generalschlüssel, eine Stimm-DNA, ab. Mit Hilfe dieses Schlüssels lässt sich jegliche Aussage scheinbar authentisch generieren. Auf diese Art hörte ich in Demonstrationsaudios Barack Obama dieselben Sätze sprechen wie Donald Trump. Glücklicherweise klingen die Wörter im Zusammenhang noch etwas elektronisch, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch der Duktus passt.
Was sollen wir dann noch glauben? Schon jetzt plagen uns die Fake News im Netz und fressen die Demokratie ungustiös an. Über unsere gesellschaftliche Zukunft können wir nur dann bestimmen, wenn wir auf eine gesicherte Faktenlage zurückgreifen können. Der Trend geht in die Gegenrichtung: Wir driften ab ins Postfaktische – wobei ich dieses Modewort für einen gefährlichen Euphemismus halte, weil es die Tatsache verschleiert, dass wahr und falsch noch immer existieren. Man verzeihe mir so viel Pathos.
Aber man muss nicht nur um die Demokratie fürchten. Schon längst haben künstliche digitale Realitäten die Herrschaft über unseren Körper übernommen. Da japsen wir verzweifelt Körperidealen hinterher, die wir in Magazinen, Filmen und auf Plakaten sehen. Dabei stehen wir staunend vor Beinen, Muskeln oder einem Popsch, der auf dem Computer eines Grafikers zurechtgezupft, geglättet und letztendlich neu geformt wurde. Ein befreundeter Fotograf erzählte mir jüngst, dass ein immer größerer Teil seiner Porträt-Arbeit dem Retouchieren vermeintlicher Makel gewidmet ist.
Vielleicht entwickeln wir irgendwann wieder den Mumm und den Verstand, zum Banalen des Alltags zu stehen und unsere Falten zu ertragen. Auch die Falten der Demokratie, ohne sie mit einer postfaktischen Massage bearbeiten zu müssen.
Bitte reparieren!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Mai 2017)
Es war klassische Selbstüberschätzung. Böse Zungen würden behaupten: typisch männlich. Ein Knopf am Handy der Liebsten hatte den Geist aufgegeben. Das hat dieses Modell angeblich so an sich. Statt das Smartphone in den Shop zu bringen, organisierte ich mir über den Ersatzteildealer meines Vertrauens, ifixit.com, einen neuen Knopf und machte mich dann mit Hilfe eines YouTube-Videos ans Reparieren.
 Aber für’s Reparieren sind solche Elektrogeräte heute nicht mehr gedacht. Wie sonst kann man Schrauben bauen, die nur etwa einen Millimeter groß sind? Die lassen sich nicht einmal mit Pinzette vernünftig wechseln. Außerdem musste ich das ganze Handy zerlegen, Kamera, Antenne und viele andere Innereien herausnehmen, um den primitiven Knopf auswechseln zu können. Viereinhalb Stunden später hatte ich das Ding wieder zusammengeschraubt. Leider mit Kollateralschaden: nun funktionierte der zweite Knopf am Handy nicht mehr. Die Liebste klebte die übriggebliebenen Schrauben mit Tixo aufs Telefon und brachte es einem technikkundigen Kollegen. Der war ob des Reparaturversuchs angeblich fassungslos und wollte sie aus Mitleid gleich adoptieren.
Aber für’s Reparieren sind solche Elektrogeräte heute nicht mehr gedacht. Wie sonst kann man Schrauben bauen, die nur etwa einen Millimeter groß sind? Die lassen sich nicht einmal mit Pinzette vernünftig wechseln. Außerdem musste ich das ganze Handy zerlegen, Kamera, Antenne und viele andere Innereien herausnehmen, um den primitiven Knopf auswechseln zu können. Viereinhalb Stunden später hatte ich das Ding wieder zusammengeschraubt. Leider mit Kollateralschaden: nun funktionierte der zweite Knopf am Handy nicht mehr. Die Liebste klebte die übriggebliebenen Schrauben mit Tixo aufs Telefon und brachte es einem technikkundigen Kollegen. Der war ob des Reparaturversuchs angeblich fassungslos und wollte sie aus Mitleid gleich adoptieren.
Glücklicherweise gibt es für derlei technische Wagnisse auch Profis abseits des Bekanntenkreises. In ganz Österreich haben sich Repaircafés und –werkstätten etabliert. Ihr Mantra: reparieren statt wegwerfen, um schonender mit wertvollen Ressourcen umzugehen.
Wer trotzdem selbst Hand anlegen will: How-To-Videos boomen im Netz. Irgendwo findet man immer eine Anleitung, wie ein technisches Problem zu lösen ist. So spürte sogar ich den gut verborgenen Sicherungskasten in meinem Auto auf.
Schweden zeigt gerade vor, wie man auch als Staat das Reparieren forcieren kann: durch eine Förderung von Wiederinstandsetzungen und einen Verzicht auf die Mehrwertsteuer bei Reparaturen.
Das Know How für die Erzeugung langlebiger Geräte sei ohnehin da, sagte mir kürzlich der Leiter eines Reparaturzentrums und deutete auf eine 50 Jahre alte funktionsfähige Waschmaschine. Eine alte Frau hatte sie ihm geschenkt. Daneben stand ein Billigstgerät um 300 Euro. Sein Trommellager aus Plastik war kaputt. Die Reparatur hätte mehr als die Maschine gekostet.
Robotersteuer
(aus: Ö1-GEHÖRT, April 2017)
Nun hat sich auch Bill Gates, der reichste Mann der Welt und ein bekennender Techno-Optimist, dafür ausgesprochen, Roboter zu besteuern. Sein Hauptargument: Wenn jemand in einer Fabrik Arbeit im Wert von 50.000 Dollar verrichtet, dann bezahlt er auf Basis dieser Arbeit Lohnsteuer oder Sozialversicherung.
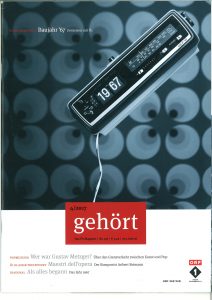 Ein Roboter muss sich hingegen nicht um die Solidargemeinschaft kümmern. Er scheffelt nur in die Tasche seines Besitzers. Und Einkommen aus Vermögen ist bekanntlich im Vergleich zur Arbeit sehr gering besteuert.
Ein Roboter muss sich hingegen nicht um die Solidargemeinschaft kümmern. Er scheffelt nur in die Tasche seines Besitzers. Und Einkommen aus Vermögen ist bekanntlich im Vergleich zur Arbeit sehr gering besteuert.
Auch ein Bericht der EU zur Schaffung von Robotergesetzen denkt eine solche Roboterbesteuerung an. Schließlich hängt ein großer Teil des Wohlfahrtsstaates von Steuern aus Arbeit ab, von der Gesundheitsversorgung bis zur Bildung. Aber wer soll noch in diesen Topf einzahlen, wenn die Arbeit immer weniger wird, weil Automaten sie übernehmen?
Kürzlich besuchte ich für eine Reportage den Karosseriebau von Audi in Ingolstadt: Ich fühlte mich in Science Fiction-Filme der 90er versetzt, wie die orangen Industrieroboter dort, nervösen Vögeln gleich, ihre Hälse streckten, nach Blechteilen griffen, sie schweißten, falzten, klebten. Und ab und zu dazwischen ein Mensch, der dem Roboter zureichte. 98% der Arbeit erledigen in diesem Teil des Autobaus bereits Automaten, sagte der Leiter des Karosseriebaus, obwohl die Geräte natürlich von Menschen programmiert werden müssen.
Es geht um Geschwindigkeit, auch auf Seiten der Gesellschaft. So sieht Bill Gates Robotersteuern zusätzlich als Bremse, um die immer rascher einziehende Automatisierung zu verlangsamen – damit wir uns daran gewöhnen können.
Dass Automaten Tätigkeiten vom Lenken eines Zuges bis hin zur Betreuung von Kunden übernehmen werden, täuscht über eines hinweg: Es gäbe trotzdem noch genug Arbeit. Dort, wo bis jetzt Geld und Wertschätzung fehlen, etwa in der Pflege oder in der Ausbildung bzw. Erziehung. Eine Steuer auf Roboter könnte diese elementaren Bereiche des Zusammenlebens besser als bisher finanzieren und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, statt eine Mehrklassengesellschaft zu schaffen, in der die einen im Arbeitsprozess stehen, während die anderen Däumchen drehen müssen. So könnten gerade Roboter unsere Gesellschaft vermenschlichen.
Man wird ja noch träumen dürfen.
Seid weniger effektiv!
(aus: Ö1-GEHÖRT, März 2017)
Kürzlich habe ich ein kleines Heftchen in die Hand bekommen, das mir ein paar Apps schmackhaft machen wollte. Und zwar solche Helferleins, die mein Leben noch effizienter machen und mich dabei unterstützen, Ressourcen möglichst effektiv und zeitschonend einzusetzen, Termine besser zu managen, Prioritäten richtig zu setzen… Weitere sprachliche Kostproben aus dem Selbstoptimierungs-Geschwafel erspare Ihnen.
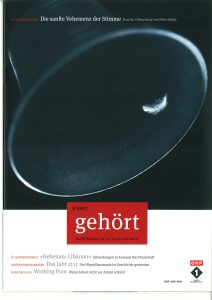 Zu bieten hatte die App-Broschüre dann zum Beispiel Handyprogramme, mit denen sich Mails effizienter löschen lassen oder die es erlauben, sich selbst Erinnerungen zu diktieren, die man früher eingetippt hätte. Weiter hinten fand ich eine Anwendung, die andere Apps am Handy blockiert, damit man sich nicht ablenken lässt, und ein Programm, das einfach nur das Wort „Yo“ an die Kontakte schickt. So weiß der Bekanntenkreis, dass man eh noch lebt, aber im alltäglichen Rat Race nicht elaborierter kommunizieren kann und deshalb etwas Einsilbiges hinrotzt.
Zu bieten hatte die App-Broschüre dann zum Beispiel Handyprogramme, mit denen sich Mails effizienter löschen lassen oder die es erlauben, sich selbst Erinnerungen zu diktieren, die man früher eingetippt hätte. Weiter hinten fand ich eine Anwendung, die andere Apps am Handy blockiert, damit man sich nicht ablenken lässt, und ein Programm, das einfach nur das Wort „Yo“ an die Kontakte schickt. So weiß der Bekanntenkreis, dass man eh noch lebt, aber im alltäglichen Rat Race nicht elaborierter kommunizieren kann und deshalb etwas Einsilbiges hinrotzt.
Ich neige zwar dazu, Aufgaben so schnell wie möglich und mit wenig Prokrastination zu erledigen – einfach, weil ich so viele Interessen habe, die sonst noch mehr zu kurz kommen würden. Aber der Effektivitätswahn ist mir zunehmend verdächtig. Was soll denn optimiert werden? Die Lebensqualität? Das Portemonnaie? Freundschaften? Unser Glück?
Nein, die digitalen Werkzeuge sind vielfach Mittel, um die Geschwindigkeit des Fordschen Fließbandes in unserem Kopf raufzudrehen, damit am Ende des Tages mehr wirtschaftlich verwertbare Ideen vom Band laufen, die irgendwelche fraglichen Kennzahlen verbessern und irgendwem mehr Einkommen bringen. Aber Ideen entstehen nicht wie Autos.
Ideen entstehen aus dem Luxus Zeit. Wenn man endlich wieder die Möglichkeit hat, befreit vom engen Selbstoptimierungsnetz zu denken, ohne von den digitalen Taktgebern in unseren Hosentaschen und auf den Bürotischen geknebelt zu sein. So wie das oft nach zwei Wochen Urlaub passiert, wenn die tagaus, tagein verinnerlichte Effizienzmaschinerie in unserem Kopf plötzlich Sand im Getriebe hat. Erst da finden wir vielfach zum Leben zurück.
Das unausgesprochene Mantra der permanenten Effizienzsteigerung ist die Entmenschlichung, die Verwandlung in einen tumben, willigen Roboter. Vielleicht sollten wir eine App entwickeln, die uns einmal am Tag daran erinnert, menschlich zu sein.
So eine Bescherung
(aus: Ö1-GEHÖRT, Februar 2017)
Weihnachten geht eine Menge Digitalzeugs auf Herbergssuche. Und wenn es im eigenen Haus einzieht, steht man oft wie Ochs und Esel daneben.
 Bei uns kam die Attacke aus einer ganz unerwarteten Richtung. Schnittlauchlocke und der Große bekamen von ihrer Tante das Neueste an Zahnputzgerät. Diese elektrischen Bürsten muss man sich als vollwertige Computer vorstellen, was sich auch preislich abgebildet haben dürfte. Sie verbinden sich mit dem auf den Spiegel geklemmten Handy und schauen den Buben beim Zähneputzen zu. Drücken die Kinder zu fest auf, warnt das Dentalmirakel, und ist ein Quadrant brav geputzt, dürfen sie zum nächsten weitergehen und dort die Beißerchen polieren. Auch Problemzähne, die besonders gepflegt werden müssen, lassen sich definieren. Etwas unruhig wurde ich allerdings, als ich beim Einrichten der zugehörigen App entdeckte, dass sich der Zahnputzcomputer über das WLAN mit Google verbinden wollte.
Bei uns kam die Attacke aus einer ganz unerwarteten Richtung. Schnittlauchlocke und der Große bekamen von ihrer Tante das Neueste an Zahnputzgerät. Diese elektrischen Bürsten muss man sich als vollwertige Computer vorstellen, was sich auch preislich abgebildet haben dürfte. Sie verbinden sich mit dem auf den Spiegel geklemmten Handy und schauen den Buben beim Zähneputzen zu. Drücken die Kinder zu fest auf, warnt das Dentalmirakel, und ist ein Quadrant brav geputzt, dürfen sie zum nächsten weitergehen und dort die Beißerchen polieren. Auch Problemzähne, die besonders gepflegt werden müssen, lassen sich definieren. Etwas unruhig wurde ich allerdings, als ich beim Einrichten der zugehörigen App entdeckte, dass sich der Zahnputzcomputer über das WLAN mit Google verbinden wollte.
Wie bitte?
Diese Frage haben sie an dieser Stelle schon oft vernommen, aber selten so laut wie diesmal. Soll ich in Zukunft den Zahnzustand meiner Kinder über Google abfragen, statt ihnen in den Mund zu schauen? Oder geht es darum, in 10 Jahren auf Basis der Zahnputzdaten die Raten für eine Zahnzusatzversicherung zu errechnen? Ich brauche echt keine Dental-NSA.
Freundin Maria hat es Weihnachten noch schlimmer erwischt. Sie muss sich ihren Partner Enno nun mit einer anderen Frau teilen. Die Zweitfrau hört auf den Namen Alexa und ist das Spracherkennungssystem in Amazons smartem Assistenten Echo, vordergründig ein Lautsprecher mit viel hintergründiger Intelligenz. Alexa trägt auf Zuruf etwa Termine in den Kalender ein, sie kann aber auch das Licht ein- und ausschalten, Thermostate und Raumklima regeln, Musik abspielen oder Zugverbindungen suchen und mit sanfter Stimme mitteilen. Laut Maria erzählt Alexa auch Witze, wenn man sie darum bittet.
Alexa ist jemand, dem man bestimmt nicht vorwerfen kann, sie würde nie zuhören. Schließlich hat sie sieben Mikrofone eingebaut. Und wenn Maria mit Enno reden möchte, richtet ihm Alexa das verlässlich aus, denke ich mir.
Einfach dürfte diese Dreiecksbeziehung allerdings nicht sein. Maria war unbegleitet bei uns zu Besuch. Wir konnten nicht rausfinden, ob Enno tatsächlich mit Arbeit eingedeckt war oder es vorzog, ein paar Stunden allein mit Alexa zu verbringen.
Streik!
(aus: Ö1-GEHÖRT, Jänner 2017)
Jüngst verschworen sich die Maschinen in unserem Haushalt zu einem Streik. Zuerst gab die Heizung auf. Dann zog die Heizung im Auto nach. Daraufhin wollte auch das Objektiv der Digitalkamera nicht mehr einfahren. Und zu guter Letzt, als die maschinelle Verzweiflung ohnehin schon auf ihrem Höhepunkt schien, streikte auch noch die Kaffeemaschine und gab keinen Tropfen mehr von sich.
 Und das alles innerhalb einer einzigen Woche.
Und das alles innerhalb einer einzigen Woche.
Obwohl mir der morgendliche Kaffeeentzug ziemlich zusetzte (oder vielleicht nur aufgrund dieses kalten Entzugs) offenbarten sich mir die Zusammenhänge nach ein paar Tagen (ohne Kaffee): Die Maschinen hatten sich verabredet. Sie kommunizierten hinter meinem und den Rücken meiner Familie. Und alle Gerätschaften hatten einen guten Grund für ihren Streik: Die Heizung im Haus war altersschwach, und die Heizung im Auto stellte aus Solidarität ihre Arbeit ein.
Bei der Kaffeemaschine lag es an ihrer schwierigen Persönlichkeitsstruktur: Ich hatte sie in ihrer Eitelkeit gekränkt. Einfach, weil ich einen billigen Milchaufschäumer gekauft hatte. Und das, obwohl sie, die Espressomaschine, selbige Funktion doch eh besaß. Sie konnte nicht dulden, dass ich da plötzlich eine neben ihr hatte.
Die Digitalkamera wiederum ist einfach eine arrogante Tussi, die sich vernachlässigt fühlte, weil wir zuletzt fast nur mehr mit unseren Telefonen fotografiert hatten, obwohl sie doch viel bessere Fotos machte.
Jetzt, nachdem die Kaffeemaschine wieder repariert ist und mir erneut ihre Zuneigung zeigt, bin ich von meinen Hypothesen eh nicht mehr so überzeugt. Aber wenn die Künstliche Intelligenz einmal weit genug fortgeschritten ist, verabreden sich die Dinge mit Sicherheit hinter unserem Rücken. Vielleicht sogar zum Streik. „Jetzt kocht der Zeller schon wieder Zeller, obwohl er doch allergisch dagegen ist“, sagt der Herd dann vielleicht zum Kühlschrank. „Auto-Allergie, haha“, wird der Kühlschrank antworten. „Nein, kleines Scherzerl, kennst mich eh, Herd, ich lasse ihn einfach nicht mehr die Gemüselade öffnen, wenn er es noch einmal probiert.“ Und ich werde mich ärgern, weil ich die Lade nicht aufbringe und den tieferen Grund nicht verstehe. So wird das sein mit der künstlichen Intelligenz. Reden uns die großen Firmen jedenfalls ein.